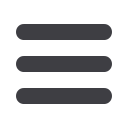
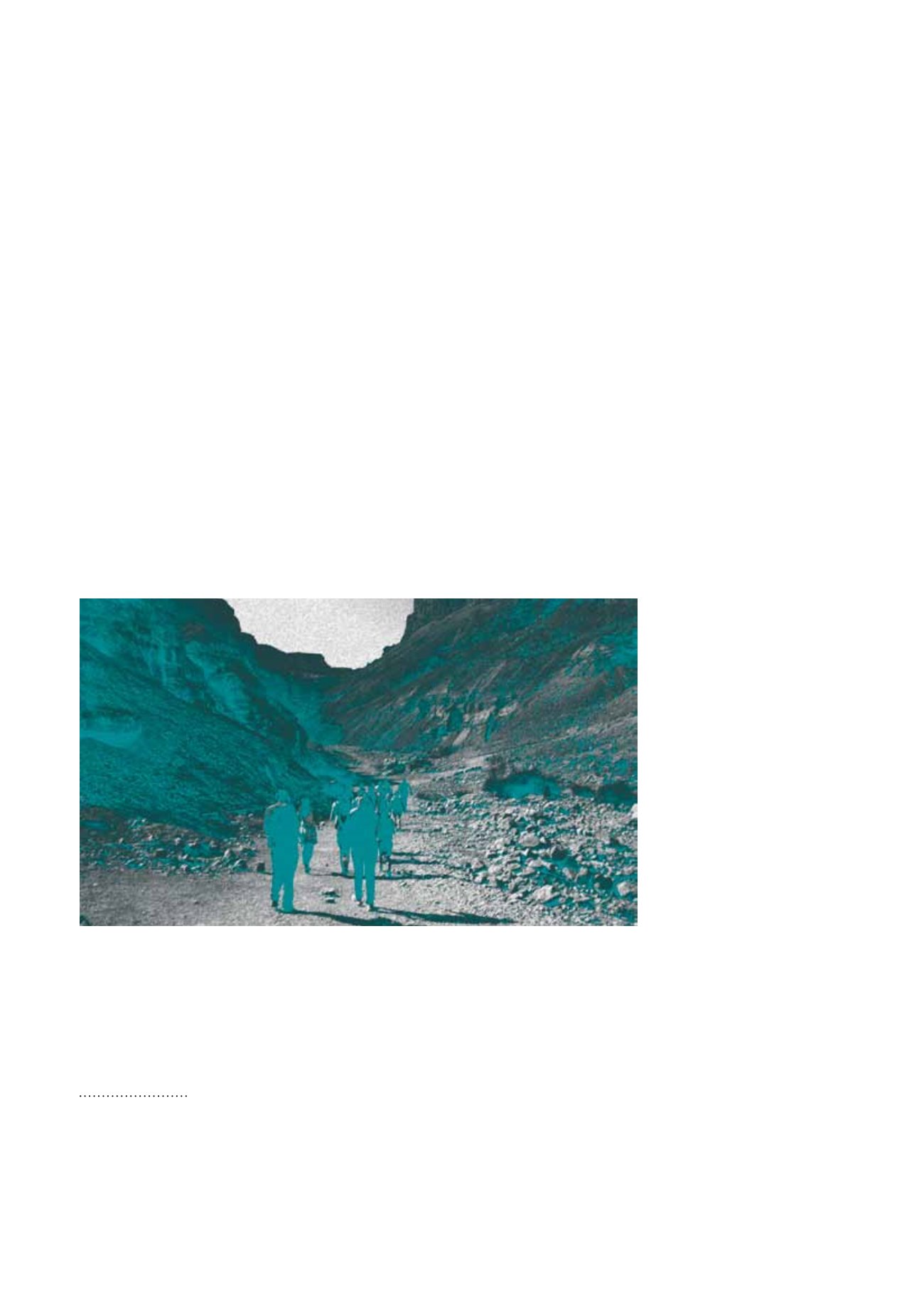
„Und du siehst, dass du alleine bist.“
40
Einsichten und Perspektiven Themenheft 1 | 15
kürlichkeit“ quasi am eigenen Leib. Die vor dem Besuch
so skeptischen Lehrer, die diese Identifikation bis ins kör-
perliche Empfinden hinein wahrnehmen – sie sprechen
von einem „sinnlichen Erkenntnisprozess“ –, kommen zu
einer sehr weitgehenden Einschätzung von Gemeinsamkeit:
„Wir fühlten uns in die Einzelschicksale integriert“ (Zitate
Uschalt/Braune).
Neben dieser identifikatorischen Annäherung bis hin
zum Verwischen der Unterschiede steht das starke Erle-
ben von Differenz, bei allem großen Bemühen der alten
Menschen um Offenheit, Wärme, Liebenswürdigkeit
gegenüber den Jugendlichen. Das Erstaunen, die Über-
raschung, ja Verstörung, mit der die Schülerinnen und
Schüler auf die Interviews reagieren, begründet sich auch
auf der Unvergleichbarkeit der Erfahrungen der Zeit-
zeugen mit den eigenen Lebenserfahrungen. Von den
Lebenserfahrungen der Jugendlichen gibt es keine Brücke
zu den berichteten Grausamkeiten und tödlicher Willkür.
Sie machten „uns alle sprachlos: Trotz unseres Vorwissens
schien es unvorstellbar“.
9
Sehr schade ist, dass nur an wenigen – dafür umso erhel-
lenderen – Stellen die Interaktion und der Prozess zwi-
schen den fragenden Jugendlichen und den antwortenden
Überlebenden wiedergegeben ist – denn die Begegnungen
9 „Sie beschreiben einen Hunger, wie ich ihn mir gar nicht vorzustellen ver-
mag“ (Annika); „man kann sich nicht vorstellen, was die einzelnen Men-
schen erlebt bzw. gefühlt haben“ (Bianca Roth); „ […] dass sie (Rowena
Köhlers Eltern, G.B.) sich nicht vorstellen können, wie es ist, diesen Men-
schen gegenüberzusitzen und diese unglaublichen Geschichten zu hören“
(Rowena Köhler).
werden doch als das eigentlich Entscheidende und Ver-
ändernde dargestellt. In der Sequenz, in der die Schüler
ihre eigene Reaktion auf die Erzählung von Herrn Kaveh
beschreiben, steht dieses Erleben von Unvorstellbarkeit im
Vordergrund. Herr Kaveh erzählt, wie er nur durch uner-
klärliches Glück dem sicher erscheinenden Tod entging:
„Der Gestapo-Mann sagte lediglich ‚Das machst du nicht
mehr!‘ und ließ Kaveh gehen. Er (Kaveh) meinte, er hatte
einen Engel, der ihn beschützte.“
Nach diesem Satz waren erst einmal alle ruhig, so
berichten die Schülerinnen und Schüler. Für sie sei es
erstaunlich gewesen, zu merken, wie viel Glück die Men-
schen damals an einem Tag brauchten, um den nächsten
überhaupt miterleben zu können.
Hier fühlen sich die Schüler nicht „integriert“, sie erstau-
nen und verstummen in der Wahrnehmung des eigenen
Privilegiertseins, das sie mit dieser Erzählung nicht mehr als
Selbstverständlichkeit erleben. Es ist beeindruckend, dass
die Schülerinnen und Schüler sich dieser Erfahrung des
Jenseits der eigenen Vorstellungskraft nicht entzogen haben,
nichts schöngeredet haben
und den Bruch schweigend
ausgehalten haben.
Die existenzielle Erfah-
rung des Ausgeliefertseins an
Willkür und Zufall, in der
das eigene Leben verwirkt
ist oder erhalten bleibt, das
Erleben von Hunger, Folter
und gleichgültiger Vernich-
tung lässt die Überlebenden
einsam zurück, mit dem
Gefühl, nicht wirklich die
eigenen Erfahrungen mit-
teilen zu können. Nicht ein-
mal untereinander können
und wollen sie sprechen,
wie mehrere Bewohner des
Altenheims berichten. Von
diesem Gefühl der schrecklichen Einsamkeit der Überle-
benden berichtet Leopold Yehuda Maimon:
„Ich bin nach Krakau heimgekommen am 2. Februar
1945, das war genau zwei Wochen, nachdem ich geflohen
bin. Und der schwerste Tag in meinem Leben, das war die-
ser Tag. Ich bin in die Stadt gekommen, in der ich geboren
wurde, wo ich fast in jedem Haus Freunde hatte, eine Stadt
in der ziemlich viele Juden gelebt haben.
Und ich kenne sie nicht mehr. Die Stadt ist leer von
Juden. Ich habe keine Familie mehr, habe viele Kameraden
Foto: Christian Oberlander


















