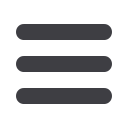

„Und du siehst, dass du alleine bist.“
42
Einsichten und Perspektiven Themenheft 1 | 15
gesetzt, immer einhergehend mit der expliziten Betonung,
dass die Nachfahren selbstverständlich keine Schuld an
der Verbrechensgeschichte der NS-Zeit treffe. Eine der
Schülerinnen, Franziska Schwendner, macht in ihrem
Kommentar zur Begegnung mit den jüdischen Überleben-
den auf den ritualisierten und beschwörenden Gebrauch
dieser Formel aufmerksam: Alle – die Eltern, die Lehrer,
die jüdischen Überlebenden versichern der Schülergruppe
immer und immer wieder, sie trügen keine Schuld. Aber
der Entlastungseffekt dieser Formel zerschellt in der Kon-
frontation mit dem fortdauernden Leid der Überlebenden
und ihrer Unfähigkeit und Unwilligkeit zu verzeihen und
sich zu versöhnen.
Die Rede von der Schuldlosigkeit der Nachkommen ist
in Bezug auf die Tat-Verantwortung eine blanke Selbst-
verständlichkeit, müsste gar nicht erwähnt werden. Wenn
man sich der eigenen Schuldlosigkeit immer wieder versi-
chern muss, belegt dies einen Bedarf nach Schuld-Entlas-
tung. Offenbar muss der Freispruch immer wieder erneu-
ert werden, weil man eben doch nicht wirklich überzeugt
ist, dass man sich als Deutsche[r] die NS-Verbrechen nicht
anzurechnen habe. Dafür, dass auch zumindest einige der
Enkel und Urenkel der Täter und Mitläufer sich nicht frei
und unbefangen fühlen in der Begegnung mit Überleben-
den des Holocaust und ihren Nachfahren, gibt es innere
und äußere Gründe.
Zum einen gehören zu unserer Identität auch Bezüge
auf unsere kollektive Vergangenheit, der Stolz auf histo-
rische Heldentaten, auf Opfer und nationale Besonder-
heiten.
16
Die nationalsozialistische Verbrechensgeschichte
taugt jedoch nicht bei der Suche nach einer guten, mora-
lisch akzeptablen kollektiven Vergangenheit, die unsere
Identität stützen könnte. Goethe und Fußball ja, aber die
NS-Vergangenheit und der Holocaust werden gern aus
dem Wir-Gefühl ausgesondert, auch wenn sie ebenso Teil
davon sind.
17
Zum anderen bildet sich unsere Identität auch dadurch,
wie wir von anderen wahrgenommen werden, und zumal
in der Fremde werden wir als Angehörige eines nationalen
Kollektivs stereotypisiert. Die jüdischen Opfer des Holo-
caust haben die Erfahrung gemacht, dass die Nazis von
einer Mehrheit der Deutschen unterstützt und jedenfalls
16 Zur Bedeutung des Kollektivs und seiner Geschichte für die Identitätsbil-
dung des Einzelnen vgl. die Arbeiten von Volkan. Vamik Volkan: Blindes
Vertrauen. Großgruppen und ihre Führer in Zeiten der Krise und des Ter-
rors. Gießen 2005.
17 So die These von Hermann Beland: Kollektive Trauer – Wer oder was be-
freit ein Kollektiv zu seiner Trauer? In: Franz Wellendorf/Thomas Wesle
(Hg.): Über die (Un)Möglichkeit zu trauern, Stuttgart 2009, S. 243–262.
nicht gehindert wurden, als sie eine rassistische Klassifi-
zierung in die Vernichtungspraxis übersetzten. Viele von
ihnen fürchten, dass sie diese destruktiven Potenzen auch
an ihre Nachfahren weitergegeben haben. Auch ohne dass
sie es beabsichtigen, vielleicht sogar gegen den expliziten
Wunsch nach einem unbefangenen und guten Verhältnis
zu den Deutschen und vor allem zu deutschen Kindern
und Jugendlichen kann es eine emotionale Barriere geben,
können Angst und Hass gegenüber dem „Volk der Täter“
weiterbestehen.
18
Wie die Berichte über die Israel-Reise deutlich zeigen,
wirken entgegen der behaupteten Freiheit und Unbetrof-
fenheit der deutschen Nachfolgegenerationen auch bei
ihnen Befangenheit und Angst vor Hass und Verurteilung
nach, die Spuren sind vor allem in den Formulierungen
der begleitenden Lehrkräfte in den obigen Zitaten deut-
lich sichtbar.
19
Hinzu kommt die Besorgnis, die intervie-
wenden Schülerinnen und Schüler – Angehörige eher der
vierten Generation – könnten „fehlendes Einfühlungsver-
mögen“ an den Tag legen, vielleicht alle Verantwortung
zurückweisen.
Wie gezeigt, macht der Bericht über die Vorerwartun-
gen die Angst vor einer Begegnung der Jugendlichen mit
den jüdischen Überlebenden spürbar. Ein Hinweis auf
das Ausmaß dieser Ängste ist dann die wirklich enorme
Erleichterung des Lehrerteams und auch der Seminar-
teilnehmer selber, als sie im Altenheim so herzlich, mit
Wärme, Offenheit, Humor, Gesprächsbereitschaft und
großem Interesse für das Interviewprojekt aufgenom-
men werden und sich die z.T. sehr alten Menschen in
den Interviews in die schmerzlichen und verstörenden
Erinnerungen an Verfolgung und Mord hineinbegeben.
Bengisu Karabacak ist es wichtig zu betonen, dass das
Schuldthema keine Rolle gespielt hätte – und bestärkt
durch diese explizite Verneinung aber indirekt dessen
Bedeutsamkeit auch für sie persönlich: „Die Menschen
haben so viel zu erzählen, von so vielen grausamen Din-
gen, aber sie sind dennoch voller Wärme und haben uns
so gut behandelt. Es war mir wichtig, zu sagen, dass man
uns keine Schuld gibt und dass wir nicht als ‚Wiedergut-
machung‘ hingeflogen sind. Sondern aus reinem Inter-
18 Über seinen Kampf mit dem Hass auf Deutschland spricht Leopold Yehuda
Maimon, er behauptet, er hätte ihn gewonnen: „Und ich habe damals ei-
nen großen Hass gehabt auf Deutschland. Aber heute will ich nicht mehr
hassen. Ich mache alles und ich spreche mit jungen Leuten, und es ist
nicht wichtig, ob es Deutsche oder Araber oder Russen sind. Weil ich nicht
glaube, dass man die Welt zum Hassen erziehen kann. Man kann die Welt
erziehen zur Liebe.“
19 Vgl. Johannes Uschalt/Tina Braune, die projektleitenden Lehrkräfte.


















